FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, Suspension zur Injektion in einer Fertigspritze
Verschreibungsinformationen
Versicherungsliste
Arzneimittel ist nicht auf der Liste.
Informationen zur Abgabe
Rezeptpflichtig
Verschreibungseinschränkungen
Keine Verschreibungseinschränkungen
Sonstige Informationen
Name des Präparats
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, Suspension zur Injektion in einer Fertigspritze
Gluten/Laktose
Gluten: Nein
Laktose: Nein
Laktose: Nein
Darreichungsform
Inj.-Susp.
Hersteller
Pfizer Pharma GmbH
Letzte Aktualisierung der Fachinformation
1.11.2023
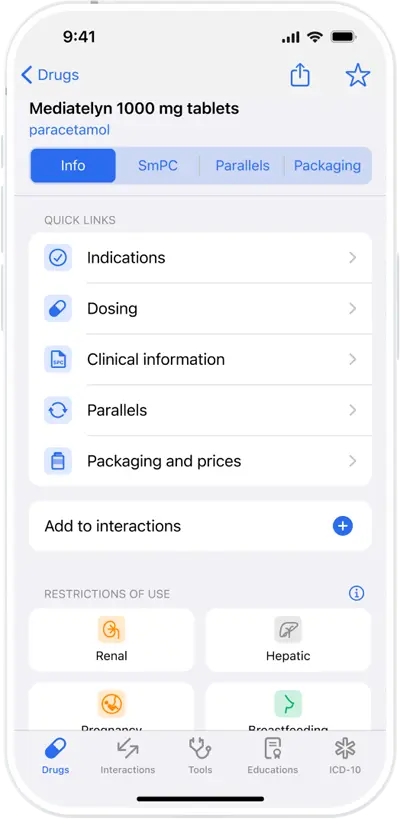
Mediately App verwenden
Schnellerer Zugriff auf Medikamenteninformationen.
Mit der Handykamera scannen.
4.9
Über 36k bewertungen
SmPC
Weblinks
Packungen und Preis
FSME-IMMUN 0,25ml Junior 1 Fertigspr. N1
Preis
53,75 €
Zuzahlung
5,38 €
Versicherungsliste
Verpackung ist nicht auf der Liste.
PZN
3100529
FSME-IMMUN 0,25ml Junior 10 Fertigspr. N2
Preis
435,52 €
Zuzahlung
10,00 €
Versicherungsliste
Verpackung ist nicht auf der Liste.
PZN
10259526