Apidra® SoloStar 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einem Fertigpen
Verschreibungsinformationen
Versicherungsliste
AOK Baden-Württemberg | AOK Bayern | AOK Bremen/Bremerhaven | AOK Hessen | AOK Niedersachsen | AOK NordOst (100395611, 100395622) | AOK NordOst (109519005, 109719018) | AOK NordWest | AOK PLUS | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | AOK Rheinland/Hamburg | …
Mehr...
Informationen zur Abgabe
Rezeptpflichtig
Verschreibungseinschränkungen
Insulinanaloga, schnell wirkende zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2. Hierzu zählen:- Insulin Aspart- Insulin Glulisin- Insulin LisproDiese Wirkstoffe sind nicht verordnungsfähig, solange sie mit Mehrkosten im Vergleich zu schnell wirkendem Humaninsulin verbunden sind. Das angestrebte Behandlungsziel ist mit Humaninsulin ebenso zweckmäßig, aber kostengünstiger zu erreichen. Für die Bestimmung der Mehrkosten sind die der zuständigen Krankenkasse tatsächlich entstehenden Kosten maßgeblich.
Dies gilt nicht für Patienten
- mit Allergie gegen den Wirkstoff Humaninsulin
- bei denen trotz Intensivierung der Therapie eine stabile adäquate Stoffwechsellage mit Humaninsulin nicht erreich…
Dies gilt nicht für Patienten
- mit Allergie gegen den Wirkstoff Humaninsulin
- bei denen trotz Intensivierung der Therapie eine stabile adäquate Stoffwechsellage mit Humaninsulin nicht erreich…
Mehr...
Sonstige Informationen
Name des Präparats
Apidra® SoloStar 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einem Fertigpen
Gluten/Laktose
Gluten: Nein
Laktose: Nein
Laktose: Nein
Darreichungsform
Injektionslsg.
Hersteller
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
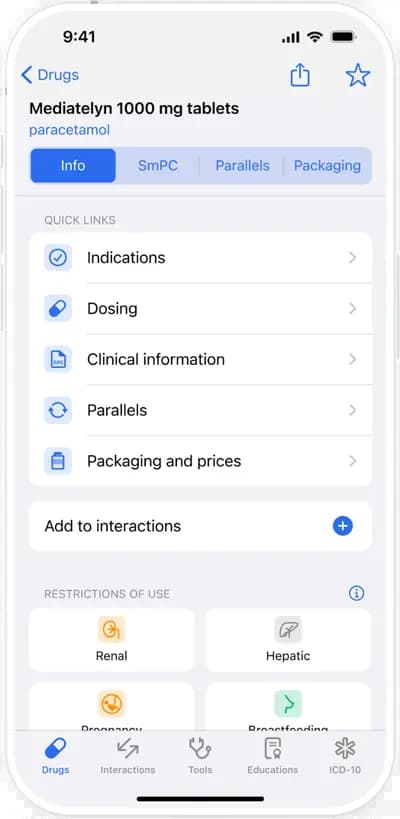
Mediately App verwenden
Schnellerer Zugriff auf Medikamenteninformationen.
Mit der Handykamera scannen.
4,9
Über 20k Bewertungen
SmPC
Weblinks
Packungen und Preis
Apidra® SoloStar 100 E/ml Fetigpen 5x3ml N1
Preis
71,13 €
Zuzahlung
7,11 €
Versicherungsliste
AOK Baden-Württemberg | AOK Bayern | AOK Bremen/Bremerhaven | AOK Hessen | AOK Niedersachsen | AOK NordOst (100395611, 100395622) | AOK NordOst (109519005, 109719018) | AOK NordWest | AOK PL…
Mehr...
PZN
5387682
Apidra® SoloStar 100 E/ml Fetigpen 10x3ml N2
Preis
128,07 €
Zuzahlung
10,00 €
Versicherungsliste
AOK Baden-Württemberg | AOK Bayern | AOK Bremen/Bremerhaven | AOK Hessen | AOK Niedersachsen | AOK NordOst (100395611, 100395622) | AOK NordOst (109519005, 109719018) | AOK NordWest | AOK PL…
Mehr...
PZN
5387699
Apidra® SoloStar 100 E/ml Fetigpen 3x3ml
Preis
-
Zuzahlung
-
Versicherungsliste
Verpackung ist nicht auf der Liste.
PZN
5553927
Apidra® SoloStar 100 E/ml Fetigpen 3x3ml
Preis
-
Zuzahlung
-
Versicherungsliste
Verpackung ist nicht auf der Liste.
PZN
14062660