Urapidil Carinopharm 50 mg Injektionslösung
Verschreibungsinformationen
Versicherungsliste
Arzneimittel ist nicht auf der Liste.
Informationen zur Abgabe
Rezeptpflichtig
Verschreibungseinschränkungen
Keine Verschreibungseinschränkungen
Sonstige Informationen
Name des Präparats
Urapidil Carinopharm 50 mg Injektionslösung
Gluten/Laktose
Gluten: Nein
Laktose: Nein
Laktose: Nein
Darreichungsform
Injektionslsg.
Hersteller
CARINOPHARM GmbH
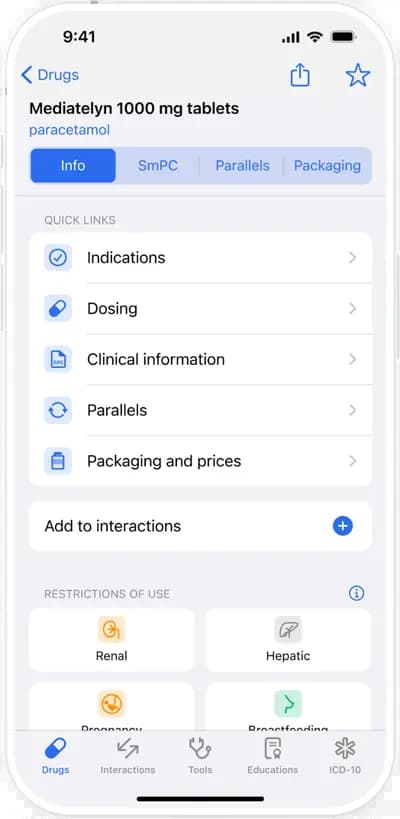
Mediately App verwenden
Schnellerer Zugriff auf Medikamenteninformationen.
Mit der Handykamera scannen.
4,9
Über 20k Bewertungen
SmPC
Wir können die SmPC-Informationen für dieses Medikament auf unserer Website nicht anzeigen. Um die SmPC-Kapitel anzuzeigen, laden Sie bitte unsere mobile App herunter.
Packungen und Preis
Urapidil Carinopharm 50 mg Inj.-L. 5x10ml Amp. N2
Preis
61,11 €
Zuzahlung
6,11 €
Versicherungsliste
Verpackung ist nicht auf der Liste.
PZN
14261419